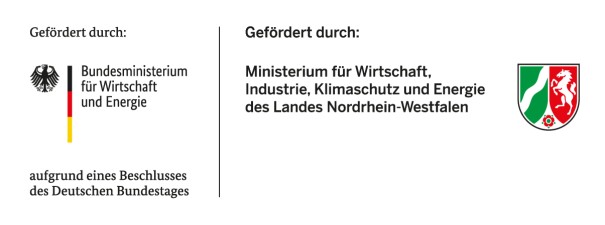bluemint® Steel
tkH2Steel®: mit Wasserstoff zur klimaneutralen Stahlproduktion
Für die Zukunft von Stahl in NRW, Deutschland und Europa stehen alle Zeichen auf Grün: Durch die Förderung von Bund und Land des Projekts tkH2Steel® von thyssenkrupp Steel am Standort Duisburg wird eine wegweisende Transformation Realität: die Herstellung von Premiumstahl mit grünem Strom und Wasserstoff in der Direktreduktionsanlage – und nicht länger im kohlebefeuerten Hochofen. Ein großer Durchbruch für den Klimaschutz, für unser Unternehmen und die Belegschaft sowie für die gesamte Region und die Unterstützer des Vorhabens in Bundes- und Landespolitik.
Aus einem der größten CO2-Verursacher, der noch für 2,5 Prozent der Emissionen in Deutschland steht, wird ein Wegbereiter nachhaltiger Wertschöpfung in Europa. Die Elektromobilität, die Energiewende, die Mobilitätswende, die Verpackungsindustrie und viele weitere Branchen – sie alle brauchen den Grundwerkstoff Stahl in höchster Qualität, aber mit möglichst kleinem CO2-Fußabdruck.
Genau den liefert schon in wenigen Jahren thyssenkrupp Steel, mit einer technologisch einzigartigen Anlagenkonfiguration: tkH2Steel®. Mit jeder Tonne grünem Wasserstoff werden dann 28 Tonnen CO2 eingespart. Nicht gespart wird aber an der Qualität: Alle bewährten Güten kann thyssenkrupp Steel auch künftig uneingeschränkt anbieten, so etwa unser Elektroband für die Energie- und Mobilitätswende.
Innovatives Herzstück des Wendepunkts der Stahlherstellung ist die Verbindung einer wasserstoffbetriebenen Direktreduktionsanlage mit zwei elektrischen Einschmelzern. Mit der Inbetriebnahme der Direktreduktionsanlage 2027 und den nächsten Schritten hin zur Klimaneutralität bis spätestens 2045 wird die nächste Generation Stahl Realität. Den Generationenwechsel vollzieht thyssenkrupp Steel im laufenden Hüttenbetrieb und am bestehenden Standort Duisburg.
So stärken wir den Industriestandort Deutschland und sichern attraktive Arbeitsplätze in der Region – 26.000 sind es direkt im Unternehmen, 150.000 in nachgelagerten Industrien in NRW. Bundesweit gilt es sogar vier Millionen Arbeitsplätze in stahlintensiven Branchen zu erhalten. Dekarbonisierter Stahl ist das Fundament industrieller Wertschöpfung, die Wachstum und Arbeit sichert. So bringt CO2-reduzierter Stahl Klimaschutz, Wohlstand und wirtschaftliche Resilienz in Einklang.
Als Großabnehmer von grünem Strom und Wasserstoff ist thyssenkrupp Steel zugleich ein Wegbereiter der grünen Energie-Infrastruktur der Zukunft. Schon die erste Direktreduktionsanlage mit ihrer Kapazität von 2,5 Millionen Tonnen direkt reduziertem Eisen (DRI) braucht jeden Tag fast 400 Tonnen Wasserstoff – das Zwölffache eines randvollen Gasometers in Oberhausen.
An den Wasserstoff- und Grünstromhochlauf knüpft sich die Erwartung weiterer zukunftssicherer Industriearbeitsplätze jenseits des Stahls. Eine Perspektive, die die Bedeutung des Vorhabens unterstreicht und für die sich thyssenkrupp Steel in die Verantwortung nehmen lässt. Die #nextgenerationsteel hat ihre Heimat an Rhein und Ruhr, doch sie denkt und handelt als Teil von Europa.


Bei der Direktreduktionsanlage handelt es sich um einen Schachtofen, der mit Erdgas oder Wasserstoff funktioniert und deshalb keine Kohle benötigt. Bei ca. 1.000 Grad Celsius wird dem Eisenerz der Sauerstoff entzogen, und es entsteht direkt reduzierter Eisenschwamm (Direct Reduced Iron, DRI). Noch im heißen Zustand wird das DRI in strombetriebenen Einschmelzern zu flüssigem Roheisen weiterverarbeitet. Durch die Positionierung der beiden Einschmelzer direkt neben der Direktreduktionsanlage wird das dort erzeugte feste Vormaterial unmittelbar in flüssiges Roheisen umgewandelt; dies macht den gesamten Prozess besonders effizient. Die Anlage mit den beiden Einschmelzern wird optimal in die umgebende Hütteninfrastruktur integriert.
Bereits mit der ersten Direktreduktionsanlage können wir im reinen Wasserstoffbetrieb bis zu 3,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das entspricht knapp 5 Prozent der Emissionen des Ruhrgebiets bzw. rund 2 Prozent der Emissionen in NRW. Bei der geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2027 wird grüner Wasserstoff noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Umso wichtiger ist, dass die Direktreduktionsanlage auch mit Erdgas in Betrieb genommen werden kann und den Einsatz von blauem Wasserstoff als Brückentechnologie ermöglicht. Zugleich investiert thyssenkrupp Steel auch in die Dekarbonisierung der weiteren Fertigungsstufen, d. h. in die Dekarbonisierung der Stahlwerke und nachfolgender Betriebe. Mit anderen Worten: Die Brücke in die klimaneutrale Zukunft steht.
Die neue Direktreduktionsanlage ist eine im doppelten Sinne überragende Investition: Als Meilenstein für die Dekarbonisierung von Stahl entsteht nach Fertigstellung eine Landmarke, die sinnbildlich für die Dekarbonisierung des Industriezentrums von Europa sein wird, genauso wie für die künftige Wasserstoff-Modellregion Rhein-Ruhr.
Engineering, Lieferung und Bau hatte thyssenkrupp Steel bereits im Frühjahr 2023 an den Anlagenbauer SMS group aus NRW vergeben. Allein durch den Bau des Anlagenparks entstehen mehr als 400 neue Arbeitsplätze. Über den Baufortschritt berichten wir fortlaufend und suchen den aktiven Dialog mit Nachbarn und Anliegern.
An der europaweiten Wasserstoffversorgung baut thyssenkrupp Steel entscheidend mit. Als Motor der Wasserstoffwirtschaft wird Europas größtes integriertes Hüttenwerk den schnellen und ambitionierten Wasserstoffhochlauf in Nordrhein-Westfalen, Deutschland, aber auch den europäischen Nachbarstaaten mit antreiben.
Als Deutschlands größter Abnehmer für Wasserstoff in diesem Jahrzehnt sind wir ein wesentlicher Treiber für den Aufbau einer entsprechenden Wasserstoff-Infrastruktur. Die Wasserstoff-Wertschöpfungskette dürfte zukünftig eine sechsstellige Zahl zusätzlicher Arbeitsplätze schaffen.
Wenn Sie Fragen zu unserer Wasserstoffversorgung haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: [email protected].
Schon im Jahr 2021 hat thyssenkrupp Steel mit bluemint® Steel eine Marke für CO2-reduzierten Stahl eingeführt, die bei Kunden auf starke Resonanz stößt. In Hausgeräten und Badobjekten, Dosen und Marmeladendeckeln namhafter Markenhersteller, aber auch Transformatoren für Umspannwerke, Verpackungsstahl für Chemikalien, LKW-Rädern und Fahrzeugkomponenten steckt bluemint® Steel entweder schon heute, oder die spätere Lieferung ist vereinbart.
bluemint® Steel ist die Marke für CO2-reduzierten Stahl von thyssenkrupp, der perspektivisch aus der wasserstoffbetriebenen Direktreduktionsanlage produziert wird. Bereits heute können Kunden mit den Marken bluemint® pure und bluemint® recycled ihren CO2-Fußabdruck bilanziell wesentlich verkleinern. Die CO2-Einsparungen erfolgen hierbei durch die Verwendung alternativer Einsatzstoffe im Hochofen.
Seit Februar 2022 ist thyssenkrupp Steel Mitglied der Initiative ResponsibleSteel® und bekennt sich damit zu den globalen Standards sowie dem unabhängigen Zertifizierungsprogramm der gemeinnützigen Organisation. Damit wird auch von unabhängiger Stelle geprüft, ob unsere Transformation zu einer klimaneutralen Stahlerzeugung soziale und ökologische Aspekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigt.
Die zwölf Prinzipien von ResponsibleSteel® erstrecken sich zum einen auf die verantwortungsvolle und nachhaltige Steuerung der Lieferkette – von der Beschaffung bis zur Verwendung und dem Recycling von Stahl. Zum anderen erstrecken sich die Standards auf Themen wie Gesundheit und Sicherheit, Wassermanagement und biologische Vielfalt, Menschenrechte und Rechte der Arbeitnehmenden sowie die Beziehungen zum lokalen Umfeld.
#nextgenerationsteel steht für den Stahl der Zukunft – aber genauso für eine nachhaltige Stahlproduktion, die Wohlstand, Beschäftigung und eine lebenswerte Welt für nachfolgende Generationen sichert. Das neue Kapitel unserer Unternehmensgeschichte ist nach der Förderzusage für die erste Direktreduktion aufgeschlagen – jetzt gilt es, gemeinsam diese Geschichte zu schreiben.
Unsere Beschäftigten wissen um die erfolgskritische Rolle unserer Transformation für den Klimaschutz. Bei uns entstehen neue Berufsbilder, Mitarbeitende werden auf den Betrieb neuer Anlagen umgeschult und somit fit gemacht für die Zukunft der Stahlproduktion. Eine Qualifizierungs- und Ausbildungsinitiative ist deshalb wesentlicher Bestandteil der Transformationsreise von thyssenkrupp Steel.
Das könnte Sie auch interessieren
Kontakt
Mark Stagge
Leiter Public & Media Relations, thyssenkrupp Steel Europe

Roswitha Becker
Pressesprecherin, thyssenkrupp Steel Europe